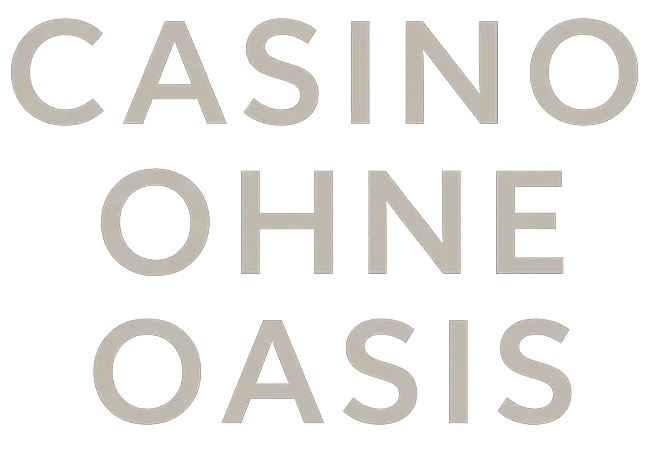Doppelfenster
online casino ohne oasisUnter einem Doppelfenster wird im Fensterbau eine Konstruktion verstanden, bei dem zwei Fenster in einer Außenwand
hintereinander verbaut werden, sodass zwischen beiden Fenstern ein Zwischenraum entsteht.
Doppelfenster sind im Prinzip die ersten Konstruktionsversuche, um einen Wärmeverlust der Innenräume wirksam
zu unterbinden. Deshalb gelten Doppelfenster als die ursprünglichen Vorfahren der modernen
Mehrfachverglasung und sogar der Glasfassaden, wie beispielsweise bei den Kastenfassaden,
die vom Konstruktionsprinzip wie Doppelfenster aufgebaut, nur wesentlich größer sind.
Zur Abgrenzung: Weist ein Fenster einen
zweiteiligen Rahmen aus zwei nebeneinander liegenden Fenstern auf, wird von einem Doppelflügelfenster, einem
Doppelschiebefenster oder bei einer festen Verglasung von einer geteilten oder doppelten Festverglasung
gesprochen. Diese Fensterarten fallen nicht unter den Begriff Doppelfenster.
Die ersten Doppelfenster wurden bereits im frühen Mittelalter verwendet. Im Laufe der langen Geschichte
entwickelten sich etliche Variationen dieses Fenstertyps.
- Die ersten Doppelfenster waren sogenannte Vorfenster, die auch als Winterfenster bekannt sind. Dabei wurde in einer Wand ein normales Fenster montiert, das in historischen Zeiten aus einer Zarge, einem Fensterrahmen und einer Einfachverglasung bestand. Kam die kalte Jahreszeit näher, wurde an Haltevorrichtungen an der Außenwand ein zweites Fenster vor das eigentliche Fenster montiert, sodass ein Doppelfenster entstand. Mit den ersten warmen Tagen verschwanden diese Winterfenster wieder im Keller oder Lagerschuppen. In der Regel bestanden diese Vorfenster nur aus einem passgenauen Rahmen und waren mit einer Festverglasung versehen, konnten also nicht geöffnet werden. Waren im Winterfenster Fensterflügel vorhanden, wurde eine Zarge benötigt.
- Kastenfenster sind die beliebtesten Vertreter unter den Doppelfenstern. Bei dieser Konstruktionsweise wurde im Fensterloch des Mauerwerks plan zur äußeren Oberfläche der Wand eine Zarge mit einem zumeist doppelflügeligem Fenster montiert. Ein identisches Fenster mit Zarge wurde nach innen gerückt und plan zu inneren Oberfläche der Wand montiert. So entstand ein Zwischenraum, der je nach Mauerstärke unterschiedlich tief war. Bekannt sind die Hamburger Fenster, die ähnlich den Grazer Fenstern auf der Wandaußenseite nach außen zu öffnen sind und im Innenbereich nach innen geöffnet werden. Beim Altberliner Fenster und beim Wiener Fenster, das auch als Wiener Kastenfenster geläufig ist, gehen alle Fensterflügel nach innen auf. Dazu war es notwendig die Fensterflügel des Außenfensters in einem kleineren Format anzufertigen, damit sie beim Öffnen durch den Rahmen des Innenfensters passen. Oftmals waren diese Fenster in der Horizontalen geteilt. So entstand in der wesentlich schmaleren, oberen Hälfte ein kleines Fenster, das nur zur Raumbelüftung geöffnet wurde, ohne gleich das gesamte Fenster öffnen zu müssen.
- Zargendoppelfenster besitzen nur eine Zarge. An der sind auf der Außenseite die Fensterflügel angebracht, die sich nach außen öffnen lassen. Dementsprechend sind auf der Innenseite der Zarge die Fensterflügel montiert, die in den Raum hinein zu öffnen sind.
- Sehr selten sind Doppelfenster als Schiebefenster anzutreffen. Dabei sind in der Regel auf einer Hälfte die Fenster fest verglast, während auf der anderen Seite die Schiebefenster nacheinander beiseite geschoben werden können.
In modernen Bauwerken werden Doppelfenster meist nur dann montiert, wenn der Fassade ein
nostalgisches Design verliehen werden soll. Dann werden Doppelfenster, insbesondere als Kastenfenster
zur perfekten Wärmedämmung, denn generell sind die Fensterrahmen mit einer Mehrfachisolierverglasung
versehen. Bei diesen Gebäuden wird dann beim Rahmen und bei der Zarge modernes Material
genutzt, wobei die Kombination aus Aluminium und Holz oder oder ein Aluminium-Kunststoffverbund wegen der
hohen Isolationswirkung ideal sind.
Sollen historische Gebäude mit neuen Doppelfenster ausgestattet werden, ist zumeist in den Vorschriften zur
Restaurierung die Verwendung von Zargen und Rahmen aus Holz vorgeschrieben, wobei zumeist Harthölzer wie
Buche, Eiche oder Nussbaum genutzt werden.
Inzwischen wurden die Vorschriften für denkmalgeschützte Bauwerke und erhaltenswerte Bauten überarbeitet. So
liegt es grundsätzlich im Ermessen der zuständigen Behörde, ob in einem historischen Bauwerk eine
isolierende Mehrfachverglasung eingesetzt werden kann oder ein Nachbau der originalen Einscheibenverglasung
vorgeschrieben wird.